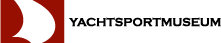Die Bootshalle des Segelclub Wiking in Berlin-Friedrichshagen
Sie ist schon ganz schön alt. Erbaut in 1912. Und so sieht sie auch aus. Irgendwie runzelig. Auch wenn das in erster Linie von diesem unsäglichen Pizzaputz kommt. Nur die Straßenfassade ist recht ansehnlich, die ist aber teilweise auch noch mit Holz verkleidet und wird regelmäßig mit Farbe und Lasur aufgehübscht. Die restlichen Seiten sind mehr oder weniger grau und verwittert.

Dafür hat sie innere Werte. Den ersten spürt man sofort, wenn man die Nase in den kleinen Seiteneingang steckt, durch den sie für gewöhnlich betreten wird. Denn sie riecht! Sie riecht gut! So richtig verdammt gut. Ein anheimelnd warmer Geruch von Kiefernharz und Holz, der, wenn die Sonne ordentlich aufs Dach scheint, noch durch eine dezente Teernote ergänzt wird. Gerade so, dass es noch einen draufsetzt.
Segelgästen zeige ich stets zuerst die Halle, bevor es dann auf meine alte Jolle geht, die es ohne die vielfältigen winterlichen Reparaturmöglichkeiten in der Halle vielleicht gar nicht mehr geben würde. Die Jolle bekommt natürlich immer ein nettes Lob – „ach, wie schön“ (ist sie ja auch ...). Aber beim Betreten der Bootshalle entfährt den Besuchern stets ein spontanes „Oh“, oder „Ah“ oder „Wow“!

Denn wenn man den ersten Eindruck der grauen Fassade draußen gelassen und den Geruch aufgenommen hat, öffnet sich einem eine lichtdurchflutete Kathedrale aus einem bunten Gewirr von Holzpfosten, -streben und -verkleidungen. Fantastisch der Anblick, wenn die Sonne ihre Strahlen durch die meist blinden Scheiben schickt und die angestrahlten Holzbalken tiefgolden inmitten der sonst dunkelbraunen Halle aufleuchten.

Schaut man dann näher hin, eröffnen sich einem viele kleine Details aus über 100 Jahren Hallengeschichte: winzige Schiebeluken in den Zwischenwänden, alte Kreideaufschriften an Türen, die seit 50 Jahren von den Schränken der Vereinsmitglieder zugestellt sind, Halterungen, deren Sinn nicht mehr zu ergründen ist, Plakate mit über 100 Jahre alten berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Hinweisen zum Verbot der Kinderarbeit in altdeutscher Frakturschrift, uralte S-Bahn-Fahrkarten in unglaublich staubigen Ecken, alte Schiebetürhalterungen ohne Türen. Was wohl noch alles zum Vorschein käme, wenn die von Spinden vollgestellten Wände freigelegt würden?
Nachdem man neugierig eine Weile in diesem lebenden Museum verbracht hat, spürt man eindringlich, dass man nur ein junger Gast in der langen Geschichte dieser Halle ist. Dass hier an Booten gearbeitet wurde, als nur einfachste Werkzeuge und Baumaterialien zur Verfügung standen. Dass man noch viele Hölzer sägen, Planken hobeln, Rümpfe lackieren und Schrauben drehen muss, bis man ebenfalls ein Teil dieser Geschichte wird.
Doch welche Geschichte? Nun, beginnen wir in irgendeinem Jahr um 1880. In Friedrichshagen am Nordufer der Spree, unmittelbar flussabwärts vom Müggelsee, nahe bei Köpenick, aber damals noch weit vor Berlin. Ein Umschlag- und Lagerplatz für Baumaterialien am Spreeufer, ein so genannter Stätteplatz, das Grundstück des heutigen Segelclub Wiking. Der Eigentümer und Betreiber Carl Otto schmückt seinen Briefkopf mit einer Schute unter Segeln – den Schlepp- und Segelkähnen, aus denen Berlin gebaut wurde. Hier wurde aber nicht nur gelagert, was die Schiffe anschleppten, hier wurde offenbar auch fleißig an Booten gewerkelt.

Unmittelbar westlich an den Stätteplatz angrenzend entstand 1879 die Bootswerft von Carl Bühnemann, die spätere Langner-Werft, Seestraße 8a – bekannt für so manche H-Jolle oder auch Jollenkreuzer. Doch dabei bleibt es nicht. Auf dem Stätteplatz gründen sich weitere Werften.
So wie um 1890 die Henkelwerft im westlichen Drittel des Stätteplatzes, direkt neben Bühnemann. Die Werft residiert in einfachen, zwischen 1890 und 1909 errichteten Holzschuppen in der Seestraße 8b. Von ihr gibt es in der Zeitschrift „Yacht“ ab 1907 bis 1921 Anzeigen zum Bau von offenen und gedeckten Tourenbooten. Auch Bühnemann (in den 20er Jahren unter Führung von Otto Eberding) wirbt hier bis etwa Ende der 20er Jahre.

Die Werft des Hermann Henkel tritt dann auch ursprünglich als Bauherr der im Oktober 1912 auf dem östlichen Drittel des Stätteplatzes errichteten heutigen Bootshalle („Holzfachwerk mit Brettbekleidung und Pappdach“) auf. Diese wird bereits im Februar 1913 wasserseitig um einen offenen Holzlagerschuppen und im Oktober 1913 um zwei offene Holzschuppen beidseits der „Schlippanlage“ zur Lagerung von Booten erweitert. In den Bauzeichnungen von 1912 taucht dann allerdings als Eigentümer die Bootswerft Wilhelm Tschuske, Seestraße 8 (heute Buttenstedtweg 26) als Eigentümer auf. In der „Yacht“ wirbt er mit bester Bedienung und billigsten Preisen.

Gemäß einer Meldeliste zur Berliner Woche von 1913 baute Tschuske unter anderem J-Jollen nach Drewitz-Rissen. In der „Yacht“ wird 1919 der Bau von zwei 15 qm-Rennjollen, zwei Ruder- und Segeljollen, sieben Einskullern, zwei Motorgleitbooten und einem Motorboot erwähnt.
Auch die Werften von Bühnemann und Henkel haben 1919 ein ähnliches Auftragspensum von Ruder- und Segeljollen. In der „Yacht“ werden alle drei Werften für den Bau hochwertiger Boote gelobt, wie überhaupt der Ort Friedrichshagen zu Beginn des Jahrhunderts zahlreiche Werften aufwies, unter anderem auch die von Max Lerche, Schulze, Grasnick und Bergholz & Gärsch.
Um 1921 findet sich für die Bootshalle erstmals die Erwähnung der „Müggelwerft - Wilhelm Tschuske Nachfolger“. Werftbetreiber ist nun ein Herr Hilgenfeld. Das Grundstück ist mittlerweile Eigentum der Gemeinde Friedrichshagen. In diese Zeit fällt auch die einheitliche – und nicht genehmigte - Überdachung der beiden offenen Bootslagerschuppen beiderseits der Slipanlage, wodurch die Bootsbauhalle eine geschlossene Erweiterung nach Süden bis zum Spreeufer erfährt, die noch heute in ähnlicher Form existiert und durch die man die Halle betritt.
Eine frühere Erwähnung des Namens „Müggelwerft“ findet sich im Internet in Form eines Eintrags über den Bau von drei Luftpropellergleitbooten als Experimentalbooten für die Marine. Es handelt sich um kleine Rennboote für den Küsteneinsatz, die mit 2 und 3 Luftpropellern ausgerüstet sind. Der Bau wird der „Müggelwerft“ in Friedrichshagen zugeschrieben und fand in 1917 und 1918 statt. Sie sollen bis 40 kn erreicht haben.
Doch auch hier bleibt der schnelle Wandel und bereits um 1924 finden sich in der „Yacht“ Eintragungen zur Müggelwerft unter (Otto) Köhler + Kuley mit dem Bau von bis zu 8 m langen Yachten. Konstrukteure sind unter anderem Otto Worm und Adolf Harms. Erwähnungen der Werften von Henkel und Köhler finden sich bis etwa 1932, vor allem durch einen lange währenden Nachbarschaftsstreit um den Gestank, der von den nicht kanalisierten Aborten ausgeht.
Ein heutiges Klubmitglied erwähnt ferner, dass der Konstrukteur und Werftinhaber aus Woltersdorf, Willi Lehmann, um 1930 kurzfristig an dem Standort an der Seestraße 8 gearbeitet haben soll und Mitglied des Segelclub Wiking Friedrichshagen war. Dem widerspricht aber der Umstand, dass er schon in den 20er Jahren Boote in seiner eigenen Woltersdorfer Werft baute.
1932 schließlich baut sich der 1921 gegründete „Segelclub Wiking Friedrichshagen“ sein heute noch bestehendes Clubheim auf dem Grundstück Seestraße 8 zwischen der Müggel- und der Köhlerwerft.

Es folgen ein paar Jahre ohne weitere Hinweise auf das Werftgeschehen bis ab etwa 1936 die Müggelwerft unter dem neuem Besitzer Richard Sange firmiert, der später dann an seinen Sohn Walter Sange übergibt. Sange baut gemäß diverser Regatta-Meldelisten zahlreiche Rennjollen. So auch die weiße J-Jolle 522 „Aera III“ von Manfred Curry (die aus dem schönen 1939er Regattafilm vom St. Moritz-See). Nach Auskunft von J-Jollen-Obmann Manfred Jakob war Sange aus J-Jollen-Sicht eine Top-Werft, seine Jollen nach Rissen von Martens und Drewitz von hoher Qualität und Geschwindigkeit. Aber auch 15er und 20er Rennjollen, meistens nach Rissen von Carl Martens sowie H-Jollen standen auf dem Programm.
Im Krieg baute Sange Rettungsboote für die Marine und stand der Naziideologie älteren Clubmitgliedern zufolge sehr nahe, was sich auch in seinen Werbeanzeigen in der „Yacht“ ausdrückt. Im Mai 1945 hat er das Weite vor den russischen Besatzern gesucht und wurde von diesen zudem aufgrund der Kriegsproduktion enteignet. Die neue russische Verwaltung hat die Werft bald nach dem Kriegsende dem Bootsbauer Erich Lerche anvertraut, der mit seinem Schwager und Tischler Rudi Uhlemann – beides aktive Gegner und Verfolgte des Naziregimes - vor allem Reparationsleistungen an die Sowjetunion erbrachte – wie übrigens auch die Langner Werft nebenan. Gebaut wurden dazu bis 1956 vor allem wiederum Rettungsboote, für die sie von den Russen das Baumaterial bekamen.

Parallel wurden aber auch Sportboote wie 10er und 15er Wanderjollen, Folkeboote, Jollenkreuzer, Stare und Kielkreuzer und die selbst konstruierten Katerjollen gebaut. Vieles erfolgte vor allem für den devisenbringenden Export. Die kleine Katerjolle hingegen wurde der Überlieferung nach von Lerche und Uhlemann bald nach Kriegsende genau auf die jeweiligen Reste des für die Rettungsboote gedachten Holzkontingentes der Russen zugeschnitten (flacher Kiefernholzboden und geklinkerter Eichenholzaufbau) und sollte für die eigenen Leute wieder eine Möglichkeit des Segelns schaffen. Die Konstruktion soll in einer alkoholreichen Nacht erfolgt sein und die Namensgebung dann am folgenden Tag dem noch schweren Kopfgefühl der Konstrukteure entsprungen sein.
Erich Lerche hat sich in der DDR zudem auch einen Namen als Konstrukteur gemacht. Anfangs waren es offenbar vor allem schnelle 20er Jollenkreuzer zu Regattazwecken, später lag der Schwerpunkt eher auf den fahrtentauglichen Booten. In den 60ern hatten es ihm vor allem die Knickspanter angetan und so stammen verschiedene Knickspantjollenkreuzer und vergrößerte Piratenjollen sowie kleinere Motorboote aus seiner Feder, die auch mit Eigenmitteln herzustellen waren. Seine Risse sind unter DDR-Jollenkreuzerseglern ebenso bekannt wie die von Manfred Ernst. Noch heute segeln im Verein diverse von ihm gebaute Jollenkreuzer.

Vermutlich in den 50er Jahren erfuhr die Halle einen grundlegenden Umbau, bei dem das Dach der Haupthalle zwei durchgehende Fenstergauben erhielt. In einer Wochenschau von 1955 wird Erich Lerche in der Bootshalle interviewt. Er berichtet auf sympathische Weise, dass er in 1955 zwanzig Boote für die Sowjetunion herstellen muss und danach drei Seefahrtkreuzer für Kanada, worüber er sich besonders freute. 1954 konnte er zudem das Boot für den DDR-Meister im 20er Jollenkreuzer stellen.
Um 1964 schließlich endet die gewerbliche Nutzung der Halle. Die Bauaufsicht lässt angeblich wegen der Baufälligkeit keine weitere Produktion mehr zu. Die Halle darf fortan nur noch zu Lagerzwecken genutzt werden. Damit ziehen sich Lerche und Uhlemann vollständig auf den nur wenige hundert Meter weiter westlich am Müggelseedamm befindlichen Standort der VEB-Yachtwerft zurück und überlassen die Halle dem Segelclub Wiking, mittlerweile in der Sektion Segeln des Dynamo Süd aufgegangen. Dieser konnte bereits 1955 das Grundstück der westlich gelegenen Henkelwerft übernehmen, von der heute nur noch eine alte Hallenstützwand zeugt und nutzt seitdem den kompletten ehemaligen Stätteplatz.
Da Lerche einerseits Mitglied im Segelclub war, sich seine Werft aber mittlerweile der Produktionsgenossenschaft des Bootsbauhandwerks angeschlossen hatte und der Dynamo-Verein sicher eine gute staatliche Unterstützung erfuhr, dürfte auch das Eigeninteresse des Segelvereins eine bedeutende Rolle an der Beendigung des Bootsbaus in der Halle gespielt haben.
Doch auch nach 1964 wurde fleißig gewerkelt. Der SG Dynamo nutze die Halle zur Winterlagerung der Boote und auch als Reparaturwerkstatt. Anfang der Siebziger wurde der kräftige Holzdielenboden durch einen Betonboden ersetzt, der noch heute – stark farbkleksig - vorhanden ist.
Vereinzelt wurden hier von den Clubmitgliedern auch noch Boote – jetzt in Kunststoff – gebaut. Doch hauptsächlich fanden und finden kleinere Reparaturen wie Schwertkastenwechsel oder Austausch beschädigter Stellen in Eigenregie statt.

Und damit sind wir wieder in der wohlriechenden Halle des heute wieder SC Wiking genannten Segelvereins. Der Blick wandert zu den Fenstern in der Dachkonstruktion, den freiliegenden gemauerten Fundamenten unter den hölzernen Stützpfeilern, die früher noch unter dem Dielenboden lagen, den bunten Farbkleksen an den Wänden und Streben, verstaubten Holzspieren, die schon lange den pflegeleichten Alumasten weichen mussten, Kreidenotizen der alten Bootsbauer an den Holzwänden, teilweise noch in Sütterlin, kleine und große Klappen und Öffnungen mit unbekanntem Zweck in den Zwischenwänden, einer hölzernen Durchreiche zur ehemaligen Schlosserei, jetzt ein zugemauerter Teil der Außenwand.
Ein gemauerter Kamin erinnert an den alten Leimofen und ein mit HWL-Platten verkleideter Teil an die dampfbetriebene Holztrockenkammer der Werft.

Und dann ist da noch die seit Ewigkeiten fest verschlossene, aber immer noch weißgekalkte alte Tür des ursprünglichen Abortes von 1912, der zu dem reich dokumentierten Schriftverkehr im Bauaktenarchiv führte
Nach der Überbauung der Slipanlage zu Anfang der 1920er Jahre lag der zuvor außen an die Halle angebaute Abort plötzlich inmitten derselben, was nach Aktenlage im Sommer zu einem infernalischen Gestank in der Werft geführt haben soll. Diese errichtete daraufhin ohne Baugenehmigung einen neuen im östlichen Außenbereich, was dann wiederum die Nachbarn auf die Barrikaden trieb. Erst in den 30er Jahren erfolgte schließlich der Anschluß an die Kanalisation, da zuvor nicht das nötige Geld vorhanden war. Ob die alten Boote wohl auch ein wenig muffelten?
An Stelle des heiß umkämpften Abortes rückte eine ebenfalls archaisch anmutende Tischkreissäge mit der heute noch so allerhand zerteilt wird. Allerdings ist jetzt klar, dass diese nicht von 1912 – sondern frühestens von etwa 1920 ist! Das passt auch gut zu ihrem Äußeren mit dem genieteten Stahlgestell.

Dann stehen da noch: die uralte Penika-Holzabrichte mit dem Siemens-Schuckert-Motor - eindeutig Vorkriegsware, aber laut und tüchtig, die farbenfroh in hellblau und rot gehaltene Seilwinde der Slipanlage – immerhin schon aus DDR-Zeiten, Regale und alte, sorgsam nummerierte Schraubenschubladen im Materialraum, Türangeln, die seit bestimmt 50 Jahren nicht mehr bewegt wurden, ein durchhängender Dachboden mit glattem Presspappenboden – ein alter Schnürboden?? Die alte Mastbank, so schief, als ob eine Erdbewegung darunter stattgefunden hätte, zwei Werkbänke, die aus dem 19ten Jahrhundert zu stammen scheinen, der originale Anschlag mit den berufsgenossenschaftlichen Regeln aus dem Jahr 1905.

Und gerade weil die Halle so alt, der Boden so grau, das Holz so braun und die Optik so matt ist, gehen hier die alten Holzboote eine wunderbare – nicht nur optische - Symbiose mit der Halle ein, wenn an ihnen gesägt, geschabt und geschliffen wird. Im Frühling spuckt sie dann aus ihrem staubigen Bauch regelmäßig frisch lackierte, glänzende Boote in die gleißende Sonne aus.
Menschen mit moderner Arbeitskleidung oder gar Kunststoffboote wirken seltsam deplatziert, ein neuerer Blechspind fast schon außerirdisch. Wer hier sein altes Boot repariert, restauriert oder auch nur gepönt hat, kann sich diese Arbeiten kaum in einer modernen Betonleichtbauhalle mit sauber gestrichenem Betonestrich vorstellen. Da fehlt eindeutig das Organische, das diese Halle mehr noch als die alten Holzboote ausmacht.

Und so ist es jedes Mal ein stiller Genuss, wenn ich spät abends im flauen Schein der Lampen mit staubigen Klamotten zwischen der alten Säge und meiner pflegebedürftigen Jolle hin und her schlurfe, um ihr eine neue Spante, Planke oder sonst ein Holzteil anzupassen. Und dabei immer mal zu den kritischen Augen der alten Bootsbauergeister im Gebälk dieser wohlriechenden alten Halle hinaufäuge, um den Stand ihrer Zustimmung für mein hemdsärmeliges Werkeln zu erfragen. Und dann und wann muss ich nach einem seltsamen Gefühl mangelnder Zustimmung das eine oder andere Holzstück doch noch einmal überarbeiten.....!

Quellen:
Bauaktenarchiv des Bezirksamtes Treptow-Köpenick,
Mitglieder des Segelclub Wiking, im Besonderen Heinz Haase
Digitales Yachtsportarchv des FKY, u.a. aus der „Die Yacht“ und „Der Segelsport“
Bilder:
Kai Svensson, Rainer Enßlin